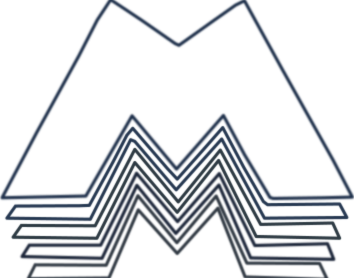Abfall - oder doch lokale Ressource?
Nicht der Zustand des Produkts, sondern die Entsorgungsabsicht entscheidet.

Laut Kreislaufwirtschaftsgesetz gilt ein Wohngebrauchsgut erst dann als Abfall, wenn der Besitzer es entsorgen will.
Gesetzlicher Hintergrund (§3 Abs.1 KrWG)
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
(1) Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss.
Gesetzlicher Hintergrund
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
(1) Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss.
Solange keine Entsorgungsabsicht besteht, bleibt ein gebrauchtes Sofa Teil des Kreislaufs.
Ob wertvolle Materialien im Umlauf bleiben oder im Abfall verschwinden, entscheiden daher die Verbraucher:innen.
Doch welche Entsorgungsalternativen stehen eigentlich zur Verfügung?
Arten der Entsorgungsalternativen
Der Kreislauf beginnt mit einer Entscheidung.
Je klarer Verbraucher:innen den Wert eines Materials und dessen Nutzungsperspektiven erkennen, desto eher bleibt es im Kreislauf.
Wer die Wahl hat, entscheidet bewusster – und trägt aktiv dazu bei, die lineare Wegwerfstruktur aufzubrechen.
Die bekannteste Entsorgungsalternative?
Weitergeben statt wegwerfen.
Ob durch Verkaufen oder Verschenken – Reuse erhält die Nutzung im ursprünglichen Zweck.
Einige Händler bieten Rückkaufprogramme an, bereiten die Produkte auf und verkaufen sie als Secondhand-Ware erneut.
Ressourcenquelle für neue Nutzungszwecke.
Ob Hacks, Remanufacturing oder freies Upcycling – viele bekannte Ansätze setzen auf kreative Umnutzung ganzer Produkte oder Produktteile.
Wir gehen einen anderen Weg: Material statt Produkt im Fokus.
Unser Ideenpool macht sichtbar, wie sich enthaltene Materialien gezielt weiterverwenden lassen – klar strukturiert, für alle zugänglich und einfach nachvollziehbar.
So entstehen alltagstaugliche Folgeprodukte, die sich mit einfachen Mitteln umsetzen lassen – und echte Auswahl schaffen für alle, die nachhaltig entscheiden wollen.
Kreislaufwirtschaft braucht lokale Strukturen.
Wer ein Produkt nicht mehr braucht, muss es nicht entsorgen – sondern sollte es gezielt weitergeben können.
Urban Mining im Alltag.
Gerade nicht mehr genutzte Wohngebrauchsgüter können zur lokalen Ressource werden – durch kommunale Zusammenarbeit und abgestimmt auf den tatsächlichen Materialbedarf vor Ort.
Dafür braucht es klare Strukturen: Sammelstellen, Zerlegung und sortierte Materialverteilung. So entsteht ein koordiniertes System, das wertvolle Materialien erhält – anstatt sie zu vernichten.
Mehr Alternativen. Mehr Wirkung.
Jede geteilte Entsorgungsalternative erweitert das Kreislaufpotenzial von lokal konsumierten Gebrauchsgütern.
Je größer diese Vielfalt, desto einfacher wird es für Verbraucher:innen, sich im Alltag für eine nachhaltigere Lebensweise zu entscheiden.
Kreislaufdenken bedeutet nicht Verzicht, sondern neue Wahlmöglichkeiten – für bewussten Konsum und mehr Lebensqualität.
Jede geteilte Entsorgungsalternative erweitert das Kreislaufpotenzial von lokal konsumierten Gebrauchsgütern.
Je größer diese Vielfalt, desto einfacher wird es für Verbraucher:innen, sich im Alltag für eine nachhaltigere Lebensweise zu entscheiden.
Kreislaufdenken bedeutet nicht Verzicht, sondern neue Wahlmöglichkeiten – für bewussten Konsum und mehr Lebensqualität.
Drei Schritte zur gelebten Kreislaufwirtschaft:
Welche Möglichkeiten gibt es, Materialien nach der Produkt-Nutzung im Kreislauf zu halten?
Wie viele Entsorgungsalternativen gibt es aktuell – passend zum Produkt und umsetzbar vor Ort?
Lokale Infrastruktur und geeignete Produkteigenschaften vereinfachen die Wiederverwendung wertvoller Materialien – und vervielfachen die Umsetzbarkeit.
Heute den ersten Schritt gehen
Wenn Markeninhaber ihre Produkte registrieren, machen wir das Kreislaufpotenzial sichtbar – als Grundlage für morgen.